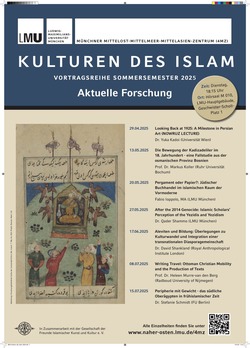Vortragsreihe Kulturen des Islam 2025: Aktuelle Forschung
Die Vorträge finden dienstags um 18:15 Uhr im Hörsaal M 010 im Hauptgebäude der LMU, Geschwister-Scholl-Platz 1, statt.
Bild: Alexander the Great and the Flying Machine from the Alexander Legend. Gotha FB. Ms. orient, T 186, BI. 252a.
29.04. Dr Yuka Kadoi (Universität Wien): Looking Back at 1925: A Milestone in Persian Art (NOWRUZ LECTURE)
Exactly 100 years ago, the American scholar Arthur Upham Pope (1881–1969) delivered a Nowruz lecture in Tehran on the occasion of his first visit to Iran. Entitled, “The Past and Future of Persian Art”, this lecture marks a turning point in the history of Persian art. The aesthetic criteria that Pope underlined in this lecture and his writings around 1925 for assessing the importance of cultural remains from modern Iran influenced the way many people worldwide came to understand the art, architecture and material culture of the Persian world at that time. My 2025 Nowruz lecture revisits the significance of this lecture by reconsidering the impact of those criteria on our thinking today.
13.05. Prof. Dr. Markus Koller (Ruhr Universität Bochum): Die Bewegung der Kadizadeliler im 18. Jahrhundert - eine Fallstudie aus der osmanischen Provinz Bosnien
Zu den bekanntesten Predigerwegungen im Osmanischen Reich zählten im 17. Jahrhundert die Kadizadeli, deren Netzwerke auch in die Provinzen des Imperiums reichten. Ihre Spuren lassen sich noch im späten 18. Jahrhundert erkennen, wie Einträge in die Gerichtsprotolle Sarajevos oder Berichte in franziskanischen und muslimischen Chroniken belegen. Zumindest traten in dieser Zeit religiöse Gruppierungen in Bosnien auf, die von der dortigen Bevölkerung als Kadezadeli bezeichnet wurden. Als Anführer betrachten die Zeitgenossen einen Seyh aus Amasya und verweisen damit auf überreregionale Netzwerke, die Bosnien bzw. den südosteuropäischen Raum mit anderen Regionen des Osmanischen Reichs verbanden. Diesem Aspekt widmet sich der Vortrag, der insbesondere die transregionalen Netzwerke von Gelehrten und Sufi-Bewegungen in Zusammenhang mit den Kadizadeli in den Blick nehmen möchte.
20.05. Fabio Ioppolo, MA (LMU München): Pergament oder Papier?: Jüdischer Buchhandel im islamischen Raum der Vormoderne
Sollen die Buchseiten aus Pergament oder Papier gefertigt werden? Ist nur ein Beispiel vieler Fragen, die jüdische Buchhändler in der Korrespondenz mit ihren Auftraggebern stellten, um ihre Wünsche bestmöglich zufrieden zu stellen. Abgesehen vom wirtschaftlichen Aspekt, werfen diese Fragen aber gleichzeitig Licht auf eine Zeit des Umbruchs im islamischen Raum, geprägt vom Aufkommen von Papier und Kodex, die einen nie zuvor gesehenen Anstieg in der Produktion geschriebener Texte mit sich brachte. Die vielen Dokumente der Kairoer Genizah, dienen dabei als ertragreiche Quelle, welche es ermöglichen die Dynamiken dieses entstehenden Buchmarktes in der Zeit zwischen dem 9. und 13. Jhd. besser zu verstehen. Auch wenn diese Dokumente unweigerlich einen Fokus auf die Geschehnisse innerhalb der jüdischen Gemeinde mit sich bringen, so lassen sich doch dieselben Erkenntnisse aus dieser Forschung auf den gesamten islamischen Raum anwenden, da die neue Produktionsweise und Form des Buches, konfessionsübergreifend Anklang fanden, und alle gemeinsam ihre Werke auf demselben weitreichenden Handelsnetzwerk teilten und verteilten.
27.05. Dr. Qader Shammo (LMU München): After the 2014 Genocide: Islamic Scholars' Perception of the Yezidis and Yezidism
The perception of Yezidis and Yezidism by Muslim scholars and jurists has historically been, and remains, a contentious issue. These views have been officially articulated through the issuance of fatwās (religious decrees) and declarations, many of which have recently been published online in the form of writings, recordings, and videos. While these fatwās and statements do not reflect the stance of all Muslims towards the Yezidis, they nonetheless serve as legal sources that delineate the status of Yezidis within Islamic communities according to Islamic Law.
This study delves into the origins of Islamic hostility toward the Yezidis and their religion by comparing historical and contemporary Islamic attitudes and actions towards them. The core focus is on examining the perspectives of Muslim jurists and scholars towards Yezidis, particularly in the aftermath of the Yezidi genocide perpetrated by the Islamic State in 2014.
The most crucial aspect of this work involves analyzing the principles behind every Islamic fatwā and official statement directed at the Yezidis, issued by representatives of Sunni Islam, the Muslim Brotherhood, Salafists, and the Twelver Shia, particularly those made in response to the 2014 Yezidi genocide. The selection criteria for Islamic entities and scholars are based on their recognized authority in Islamic scholarship and their involvement in religious dialogue, especially concerning Yezidis. This analysis will also include historically significant Islamic decrees issued by known scholars that have shaped Muslim attitudes towards Yezidis for centuries and set the stage for subsequent religious rulings. Additionally, it explores the motivations behind these fatwās and statements, as well as their impact on the Yezidis. The goal is to determine whether the recent Yezidi genocide and the brutal actions of ISIS (Dāʿaš) jihadists have led Islamic jurists and scholars to reconsider their views on Yezidis and Yezidism, potentially ending the historical cycle of Islamic violence against Yezidis, paving the way for peaceful coexistence between Yezidis and Muslims, and reducing religious-based conflicts, as has been achieved with other ethnic and religious groups in the past.
17.06. Dr. David Shankland (Royal Anthropological Institute London): Aleviten und Bildung: Überlegungen zu Kulturwandel und Integration einer transnationalen Diasporagemeinschaft
Seit fast vier Jahrzehnten habe ich das Privileg, als Sozialanthropolog mit der alevitischen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten. In dieser Zeit habe ich mich besonders mit der Art und Weise beschäftigt, wie sich die Bevölkerung eines türkisch-alevitischen Dorfes in Anatolien im Laufe des 20. Jahrhunderts verändert, vergrößert und seine Bevölkerung ausgewandert ist, z.B. nach Deutschland, nach Österreich und in die Schweiz, aber auch interhalb der Türkei, insbesondere nach Istanbul. Von vielen möglichen Fragen ist ein Bereich, den ich in meinem Vortrag besonders erörtern möchte, die Frage, wie Religionsunterricht für das Schulsystem in Europa konzipiert werden kann. Das ist viel schwieriger, als es sich anhört. Es kann in der Tat sein, dass jener Vorschlag, wie ich ihn hier anbiete, ebenso viele Nachteile wie Vorteile mit sich bringt. Aber selbst ein solcher Versuch wirft zahlreiche Fragen von weitergehendem Interesse auf, wie z.B. Authentizität, kulturelle Überlieferung, die Beziehung zwischen mündlichen und schriftlichen Traditionen, Legitimität und vor allem Relevanz.
08.07. Prof. Dr. Heleen Murre-van den Berg (Radboud University of Nijmegen): Writing Travel: Ottoman Christian Mobility and the Production of Texts
From the perspective of some of the key findings of our project Rewriting Global Orthodoxy, Oriental Christians in Europe (1970-2020) I will revisit some of my earlier work on Syriac Christians in the Ottoman Empire. Insights in how, in the contemporary period, travel and transnational connectivity, within confessional Christian communities and among them, had a major impact in how these communities put reading and writing, learning and teaching to work as a major tool for the stability and flourishing of their communities, in new diasporic communities as much as in homelands in turmoil. Rather than taking the writing of books and manuscripts for granted as a standard element of the cultural production of these Christian communities, I propose to see this literary production and the accompanying learning strategies as the kernel of how these communities renew themselves over time, in different locations and contexts. A new look at the Syriac communities of the Ottoman period will situate these contemporary trends in a historic context, and will put new light on the developments of that period, in which similar processes of mobility and inter-confessional exchange stimulated literary and communal renewal in which the production of texts played a crucial role.
15.07. PD Dr. Stefanie Schmidt (FU Berlin): Peripherie mit Gewicht - das südliche Oberägypten in frühislamischer Zeit
Assuan, eine Stadt am Ersten Katarakt Ägyptens, blickt auf eine lange Tradition als Produktions- und Handelszentrum zurück, die sich von der pharaonischen bis zur islamischen Zeit erstreckt. Die strategische Lage an der Grenze zu Nubien und der hiermit verbundene grenzübergreifende Handel, die Ausbeutung der Goldminen im nahen Wadi Allaqi durch arabische Stämme sowie Assuans Lage an der Pilgerroute nach Mekka waren stimulierende Faktoren für seine kulturelle und wirtschaftliche Blüte im 11. und 12. Jh. Doch welche internen und externen Parameter begünstigten die Entwicklung dieser peripheren Region in der Frühphase islamischer Herrschaft über Ägypten? Wer waren die zentralen Akteure innerhalb der früh-islamischen Gemeinschaft Assuans, die soziale und wirtschaftliche Beziehungen in der Stadt und ihrer Umgebung etablierten und festigten? Und welches Interesse veranlasste den Kalifen al-Maʾmūn (813–833) sich dieser Region persönlich anzunehmen?
Der Vortrag geht diesen Fragestellungen nach und legt hierbei ein besonderes Augenmerk auf die administrative Position Assuans innerhalb Oberägyptens. Dabei werden neue Überlegungen zur Einordnung Assuans in das Gebiet von al-Ṣaʿīd vorgestellt, die sich durch die Lektüre der Werke der arabischen Historiker sowie der papyrologischen Evidenz ergeben.
Organisation: Münchner Mittelost-Mittelmeer-Mittelasien-Zentrum (LMU München) in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft der Freunde Islamischer Kunst und Kultur e.V.
Auf mehrfache Anregung hin möchte der Vorstand des 4MZ die Dienstagabend-Vortragsreihe im Sommer 2026 durch einen ganztägigen 4MZ-Forschungstag ersetzen. Bitte, reservieren Sie sich nun Freitag, 12. Juni 2026, 9-17 Uhr. Damit wollen wir den Austausch und die Vernetzung innerhalb des 4MZ stärken. An den Dienstagvorträgen sind das ganz treue Stammpublikum und eher die fachnahen Kolleginnen und Kollegen anwesend, für diesen Forschungstag aber planen wir für den Vormittag Impulsvorträge „mit Ecken und Kanten“ aus möglichst vielen Fächern, dann ein gemütliches Mittagessen inmitten von Postern, schließlich am Nachmittag einen oder mehrere runde Tische zu Projektideen. Dabei ist das weitere interessierte Publikum, selbstverständlich, mit eingeladen.
Die Vortragsreihen früherer Jahre finden Sie hier.
Downloads
- 4mz_sose_2025_blau (543 KByte)